Lyrik – eine kleine Philosophie über das Dichten
Hinaus übers Ich und via Ihr hinein ins Wir: Das seltsame Verständnis des Ingo Munz von Lyrik.
Dichtung trägt keine glitzernden Steppjacken, Dichtung kaut keine Kaugummis, sie fährt keine dicken Autos und Dichtung legt auch nicht in Menschengetümmeln die Hand auf die Schultern anderer, um schneller vorwärtszukommen. Dichtung ist bescheiden. Dichtung hat keinen Beruf. Dichtung ist absolut – eine kleine Philosophie über das Dichten:
Das Lebensgefühl als Grundlage aller Poesie
Man kennt die steifen Partys, freilich, und die noch steiferen Empfänge, wo viele einander misstrauisch beäugen und wo deshalb, so nicht einer Erbarmen zeigt und freiwillig den Narren gibt, sich ein fürchterliches Gespräch an das nächste reiht. Höhepunkt solcher Gespräche sind die Frage: Und, was machen Sie so beruflich? Antworten Sie einmal, freilich nur, wenn Sie tatsächlich dichten: Ich bin Dichter. Aus meinen Erfahrungen lassen sich drei Arten von Antworten ableiten. Es gibt nur diese drei Antworten, die Existenz einer vierten Antwort ist nicht nur unmöglich, sie ist auch ganz entschieden undenkbar.
Jedenfalls antworten einige wenige lapidar: Das ist ja interessant! Noch bevor sie ihr Dahingesagtes zur Gänze so dahin gesagt haben, schielen sie bereits etwas angewidert, in jedem Falle aber reichlich angeödet in Richtung Buffet. Sie nehmen mich und meine Antwort nicht ernst, und ich fühle mich wie ein Eisverkäufer im Land der Eskimos. Ein anderes, ebenfalls recht übersichtliches Grüppchen, reagiert auf mein Ich bin Dichter mit einem halbwegs gestammelten Ach ja? Es sind dies die Menschen, die einen für den Rest der Party wie einen Außerirdischen angaffen und alle anderen Partygäste nach und nach ins Vertrauen ziehen: Dort hinten, seht ihr den? Das ist ein Dichter! Hinwiederum der große Rest, meine Erfahrungen sprechen von weit über achtzig Prozent, annähernd jeder also stellt nach meiner Antwort Ich bin Dichter eine weitere Frage, die in Wortwahl und Tonfall immer identisch klingt, sie lautet:
Und, kann man davon leben?
Ich habe mir angewöhnt, zunächst recht lange tatsächlich recht außerirdisch dreinzublicken. Danach hebe ich meinen linken Arm und beobachte seelenruhig die zum Arm gehörige Hand, wie sie den Arm so großartig fortführt, um dann in einem magischen, mir fast mystisch erscheinenden Fingerspiel zu enden. Dasselbe vollführe ich hernach mit rechtem Arm und rechter Hand. Wenn dann noch Zeit ist (und meistens ist Zeit!), stampfe ich sachte mit den Beinen und wiege zu guter Letzt den Kopf langsam hin und wieder her und sage:
Es deutet einiges auf gewisse Formen von Lebendigkeit hin. Nun sind es meine Gegenüber, die recht außerirdisch dreinblicken. Und auch die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus: Die einen zeigen sich anschlusskommunikativ und fragen beispielsweise Worüber schreiben Sie denn so?, andere fühlen sich wohl veräppelt und suchen rasch das Weite. Dazwischen sind unübersichtlich viele weitere Reaktionsvarianten möglich. Gott sei Dank lassen sich diese nicht länger in ein empirisches Korsett oder prozentuale Verteilungen zwängen. Manchmal bereue ich, dass meine Antwort derart ausfällt. Denn sie mutet mir vor allem jetzt, da ich über sie schreibe, sehr clownesk an, arg aufgesetzt und übertrieben eigenbrödlerisch. Vielleicht sollte ich zukünftig sagen: Man lebt nicht von Dichtung, man lebt durch Dichtung. Dies klänge, glaube ich, weniger polemisch und irgendwie gescheiter!
So oder so: Wenn man wie ein Schulbube ausgefragt wird, ob man denn von Dichtung leben könne, obwohl doch alle wissen, dass selbst Goethe nicht von Dichtung allein leben konnte, dann scheint es bei dem Wesen von Dichtung nicht allein um sprachliche Finesse, Rhythmik oder gar Inhaltliches zu gehen; vielmehr findet die nur vorgegaukelte Verwunderung wohl ihren Ursprung im Unverständnis darüber, dass ein Mensch ein Leben lang Buchstaben unter ästhetischen Gesichtspunkten ordnet, obwohl ihn keiner darum bittet und diese komische Chose aus Ästhetik und Zeitvertreib mithin selten in bare Münze umgesetzt werden kann. Gerade in unserer heutigen Welt – und hier stock‘ ich schon, denn verfertige ich ausnahmsweise und ein einziges Mal eigene Gedanken, so kann ich mir keine Zeiten vorstellen, in denen profane ökonomische Interessen, der Pragmatismus und genereller Eigensinn nicht Hauptantrieb menschlichen Handelns gewesen wären, ja ich glaube sogar, dass der Herrgott, lange bevor er Himmel und Erde in Stand setzte, die Zahlungsmittel erfunden hat – gerade also in jener Welt, die wir vorzufinden tagein, tagaus genötigt sind, muss ein Treiben, das nicht auf Pinke Pinke angelegt ist, außerordentlich verblüffen.
Kleine Schwärmerei
Trifft Neunmalklug Zehnkäsehoch.
Ich drücke mich unverständlich aus? Ich beginne andersherum: Wieso sind und waren so viele Dichter von Hause aus Arzt? Es gibt wohl keine sinnvollere Tätigkeit als die des Arztes, darin werden wir überein gehen. Und auch die anderen Menschen in den heutzutage geldwerten Berufen, ohne die die Welt glaubt nicht mehr auskommen zu können, wie Jurist und Steuer- oder Finanzfachmann, auch sie kämpfen doch, sind wir ehrlich, mit der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. In einer Welt, in der, je dekadenter die Welt ist, mehr und mehr nach dem Sinn des Ganzen gefragt wird, müssen sich Arzt, Jurist und Steuerexperte vollkommen fehl am Platze fühlen. Sie müssen nachgerade und irgendwann die Schnauze voll haben von der Sinnhaftigkeit des Knochensägens, des Streitschlichtens und des Aufaddierens von ganzen und sogar rationalen Zahlen. Sie müssen regelrecht gieren nach einer sinnlosen Beschäftigung, und so fangen sie also an zu dichten.
Naturgemäß suchen Sie jetzt inwendig nach Dichtern von Rang, die nicht hinein in eine dieser Schablonen passen. Aber Goethe, Schiller und Kleist, Gottfried Benn, Arthur Schnitzler und Anton Tschechow, Heinrich Heine, Georg Büchner und E.T.A. Hoffmann passen wunderbar. Freilich fehlen noch die Dichter, die den erlernten Beruf im Grunde genommen nie ausgeübt haben, wie beispielsweise Peter Handke oder Rolf Dieter Brinkmann. Und letztlich, das gebe ich zu, fehlen all jene schlauen Geister, die sich gar nicht erst belastet haben mit einem so genannt sinnvollen Beruf, wie Bertolt Brecht und Arthur Rimbaud, wie Thomas Mann und Georg Trakl.
Ich habe weit ausgeholt. Was ich sagen will: Ein Dichter ist ein Dichter, ein Dichter ist kein Arzt. Der Dichter hat keinen Beruf. Ein Dichter ist absolut, wenn er schreibt. Er arbeitet nicht, denn während er dichtet, strebt er nach nichts, außer vielleicht nach dem ganz großen Ideal, von dem aber just der Dichter weiß, dass es das Ideal gerade in seinem Genre nicht gibt. Die Freiheit des Dichters besteht nicht, wie häufig angenommen wird, in formellen oder gar grammatikalischen Dingen, also der Freiheit, die er sich wie von selbst verständlich nimmt, indem er experimentiert, indem er beispielsweise anagrammiert oder sich auf die Verwendung eines bestimmten Vokals kapriziert oder, indem er einfach mitten im Satz – nein, dieses ist nicht die Freiheit des Dichters! Die Freiheit des Dichters liegt in der Anmaßung, in der Ungeheuerlichkeit etwas zu vollbringen, was die Etablierung und Sicherung der eigenen Existenz im Grunde genommen untergräbt. Insofern werden Sie auf dieser Welt nur schwer einen (wahren) Dichter finden, der nicht bereitwillig Brüderschaft trinken würde mit jenen abgeklärten Herren, die die Irrwege des Fatalismus so hochmütig beschreiten. Oder noch deutlicher: Mit dem Verzicht auf finanziellen Ausgleich erkauft sich der Dichter ein Lebensgefühl, von dem der arbeitende Dramatiker, der disziplinierte Romancier, aber auch der Arzt, der Jurist und der Steuerfachmann zu träumen nicht wagen. Dieses Lebensgefühl ist Grundlage der Dichtung, weil es hilft, über das (eigene) Leben hinaus in fremde, reale und hyperreale Welten zu äugen, weil es hilft, sich in grotesk schlechte und absurd bessere Welten zu beamen.
Über den Einsatz von Verstand in lyrischen Machwerken
In guten Gedichten vermeidet der Dichter den Einsatz von Verstand, in sehr guten Gedichten hat er ihm längst abgeschworen, dem Verstand, hat ihn längst hinter sich gelassen. Etwas neckisch könnte ich formulieren, die Dichter müssten sich die Wissenschaftler zum Vorbild nehmen – und immerzu nur das Gegenteil machen. Schließlich haben jene Gelehrten sich selber längst entlarvt als wiederkäuende Hornochsen, die beträchtlich leiden unter kindlich-neurotischen Methodenzwängen und die mit ihrem verfluchten Verstand, darüber sind sie sich einig, im Grunde genommen immer nur das beweisen, was gerade Zeitgeist ist. „Aber was soll’s“, sagen sie, widerlegen einander fast täglich und halten sich und den Verstand gleichwohl für die Krone der Schöpfung. Dieses darf der Dichter sich nicht leisten! Seine Wahrheiten sollten hinter dem Verstand liegen, getreu der Einsicht: Wer beim Nachdenken zu viel Verstand in die Waagschale wirft, läuft Gefahr Atombomben zu bauen.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Soll mir doch keiner kommen und sagen, er wisse und erkenne die tiefere Wahrheit hinter diesen Zeilen! Freilich darbt in uns eine schwüle Ahnung von dem, was mit wachsenden Ringen gemeint sein könnte. Und dieses Kreisen! Ringe, Falke, Kreise, ein Sturm oder doch ein großer Gesang? Dieses Gedicht ist ein gewaltiges Fragezeichen und dennoch legt sich ein wissendes Lächeln ins Antlitz all jener, die es fasziniert wieder und wieder anhören müssen. Ich bin überzeugt: Ein Gedicht, das sich über den Verstand packen lässt, ist keines, zumindest kein sehr gutes.
Der Irrweg
Und so, über das allmähliche Verfertigen dieser Gedanken zu meinem Verständnis von Lyrik, erfahre ich, warum just dieser Text nicht lyrisch sein kann, wenn es auch mein Wunsch wäre. Denn selbstverständlich möchte ich Schritt für Schritt vorgehen, möchte zur besseren Lesbarkeit des Textes meine Gedanken bündeln, geeignete Überschriften finden und Sie, verehrter Leser, wie in einem Aufsatz oder in einem guten Roman zur richtigen Zeit versorgen mit meinen vorsortierten Gedankenbündeln – ein Unterfangen, das ohne den Einsatz von Verstand nicht gelingen kann. Dieser Text kann mithin nicht lyrisch sein, selbst dann nicht, wenn man mit einiger Gewalt und im Nachhinein Rhythmus und allerlei Metaphern oder Pleonasmen in den Text träufelte. Man erkennt übrigens sehr gut, wenn mancher manchen Text mit derlei dichterischen Mitteln „pimpen“ möchte. Dass er den Text damit lediglich „verunschönert“, ihn regelrecht vergewaltigt, hängt damit zusammen, dass er gerade nicht aus einer lyrischen Stimmung heraus geschrieben wurde; seine „Verschönerungen“ sind sinnvoll, geplant und durchdacht, sind ganz einfach allzu sehr am Verstand orientiert.
Die Imbissbudenverkäuferin
Ich trage Bier- und Fleischgeruch
Mit mir herum und ein rotes Tuch
An meinem Halse sitzt,
Weil ich geschwitzt
In meiner Imbissbude.
Man spürt es sofort: Irgendetwas stimmt nicht mit obigem Gedicht. Ist es eine grammatikalische Ungereimtheit? Erfordert geschwitzt nicht ein haben? Und überhaupt, ein rotes Tuch, Bier, Fleisch: Was soll das Ganze? Steckt gar eine politische Aussage dahinter, reichlich platt formuliert? Ich will das Gedichtlein nicht überhöhen, was ja auch gar nicht möglich wäre. Und unverschämt ist es vielleicht, es in einen Absatz mit Goethes Osterspaziergang zu packen. Sie wissen schon: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche… Diese süße Melodie, diese großartigen Verse! Als ich sie zum ersten Male las, ich befand mich auf dem Nachhauseweg und hockte in einer vollbesetzten Straßenbahn, vergaß ich vor bewundernder Begeisterung zunächst mich, vergaß dann den rechtzeitigen Ausstieg und mochte die letzten Zeilen
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!
Entsetzt von dem, was möglich ist
Einfache Satzstellungen misslingen,
Zeiten schwirren umher wie orkangebeutelte Papierfetzen,
Die Eigentümlichkeiten des Lebens verschwinden
Unter den Einflüssen alles Aktivischen
Und werden doch gleichzeitig zerrissen von allem, was passivt.
Hauptwörter wörtern, ganz plötzlich,
Und Verben verbumen!
Perspektiven verschmelzen zu Klumpen von Aspekten.
Folgerichtigkeiten bleiben folgenlos,
Und Unverständlichkeiten umschmeicheln jetzt meinen Verstand wie Tulpen vielleicht fliegen können.
Bin ganz entsetzt von dem, was möglich ist!
Hinaus übers Ich und via Ihr hinein ins Wir
Ganz große Dichter sind wir alle, wenn wir verliebt sind, freilich! Ach, wie herrlich sich die Welt doch dann verjüngt und sich vereinfacht auf dieses eine schwüle Ziel! Wie es in uns brodelt und wuchert und tobt und trieft und was wir als solcherart Empfindungsbombe nicht alles in uns spüren? Freiwillig gefangen in der Zweieinigkeitsblase wird erweckt zu prallem Leben – alles! Wer sollte außer uns und gerade jetzt im Stande sein, Derartiges zu empfinden? Das Gefühl von Einzigartigkeit nimmt Besitz von uns und wir haben das große Bedürfnis, diese, wie wir im verliebten Zustand glauben, einmaligen Empfindungen mitzuteilen. Die Buchstaben fallen wie von selbst aus uns heraus und schmiegen sich aneinander zu einem süßen Wortwohllaut. Ja, schnell alles niederschreiben, denken wir, bevor die Bombe hochgeht und die Blase platzt, die zweieinige.
Es gibt noch eine zweite Art von Lebensphase, in der es uns besonders leicht fällt, Dichter zu sein: Ich meine die Zeit der unerhörten Begebenheiten, erlebt und erfahren am eigenen Leibe. Begebenheiten, die fast ähnlich stark von Emotionen begleitet werden wie das Verliebtsein. Beispiele gibt es unendlich viele, von der Wunderheilung oder der Geburt des Kindes, über den spannenden Urlaub im Amazonasgebiet, bis hin zu der Zeit als Bundespräsident, als Medienstar oder als Zeitgenosse des Prager Fenstersturzes et cetera. Hier führt das Leben höchstpersönlich Feder. Wieder – man möge die Floskel verzeihen – wieder brennt etwas unter den Nägeln und will hinaus in die Welt, will ganz einfach erzählt werden. Bewusst schreibe ich „erzählt“, denn aufgrund der weniger starken emotionalen Bindung fällt es uns schon nicht mehr so leicht, das Erlebte in Poesie zu fassen.
Jetzt aber die Frage: Sind wird andauernd frisch verliebt und erleben dauerhaft Sensationelles? (Ein kleiner Ausritt: Erlebten wir dauerhaft Sensationelles, würden wir nicht dichten, und zwar nicht nur deshalb, weil dafür gar keine Zeit wäre…) Oder anders gefragt: Reichen die Lieben und unerhörten Begebenheiten im Leben aus, um ein (Lebens-)Werk ausfüllen zu können? Ganz gewiss nicht! Was also nun? Was also tun, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, tagein, tagaus zu dichten?
Der Ausweg liegt für die meisten Dichter in dem, was die Literaturwissenschaften mit Befindlichkeitslyrik bezeichnen und was den Übergang vom Ich zum Ihr darstellt; der Übergang also von der Frage: Was habe ich erlebt? zur Frage: Was erlebt ihr? Dieser Übergang oder Unterschied wird deutlich durch den Blick auf den Leser. Der Leser kann mehr oder minder nur passiv beiseite stehen, wenn der Dichter schildert, was er fühlte, dachte und empfand, als er verliebt war oder den Prager Fenstersturz beobachtet hat. Er kann dies sympathisch oder unsympathisch finden, mehr aber auch nicht, denn er hat ja das Beschriebene nicht erlebt. Anders sieht es aus, wenn der Autor beschreibt, was er fühlt, denkt und empfindet beim Anblick dieses oder jenes Baumes. Der Leser kennt ja den Baum, er weiß um sein eigenes Fühlen, Denken und Empfinden beim Anblick des Baumes.
Womöglich vollzieht der Dichter diesen Übergang vom Ich hin zum Ihr nicht bewusst. In jedem Falle aber eröffnet er damit die Möglichkeit der Abgrenzung und geht den Schritt in die Schusslinie der Öffentlichkeit. Es ist der Beginn von Poesie. Dass die Poesie an diesem Übergang nicht endet, dass sie nicht enden sollte beim Beschreiben eines Gefühls, eines Gegenstandes oder einer Begebenheit wird manchem einleuchten. Es bedarf eines weiteren Schrittes. Ich denke, dass dies ein Schritt zurück sein muss, zurück vom Ihr zum Ich, wobei das Ihr diesen Schritt zurück mitgeht, damit es dem Ich vorstellig werden kann. Dies ist der zweite Übergang, das Aufeinandertreffen von Ich und Ihr, das wir Wir nennen. Zum Ende meines »literarischen Verständnisses« möchte ich mit Ihnen diskutieren, wie dieses Wir, das wir ja lieben und fürchten zu gleichen Teilen, wie dieses Wir beschaffen sein kann, wie dieses Wir beschaffen sein sollte und – das Wichtigste – ob sich die Beschaffenheit dieses Wir überhaupt beeinflussen lässt.
Als unsere Gesprächsgrundlage soll dienen eine um 1930 im Hörfunk ausgestrahlte Debatte zwischen den beiden Dichtern Gottfried Benn und Johannes R. Becher. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlag Klett-Cotta. Mein persönlicher Dank gilt Frau Caroline Grafe.
Quellenverweis:
Gottfried Benn: “Dichtung an sich. Rundfunkgespräch mit Johannes R. Becher (1930)”, in: Ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Szenen und andere Schriften, Bd. VII, 1, hrsg. v. Holger Hof. Stuttgart 2003, S. 217 – 221.
Gottfried Benn: Dichtung an sich, das ist vermutlich nicht Ihre These, Herr Becher, welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus ihr gegenüberstellen?
Johannes R. Becher: Ich von meinem Standpunkt aus vertrete die These: Dichtung als Tendenz, und zwar als ganz bestimmte Tendenz.
Gottfried Benn: Welche Tendenz, Herr Becher, wollen Sie mit Ihrer Dichtung vertreten?
Johannes R. Becher: Ich verfolge mit meiner Dichtung die Tendenz, die heute meiner Ansicht nach jede Dichtung aufweisen muß, die Anspruch darauf macht, eine lebendige Dichtung zu sein, das heißt eine Dichtung, die in den entscheidenden Kräften dieser Zeit wurzelnd, ein wahres und geschlossenes Weltbild zu gestalten vermag. Ich diene mit meinen Dichtungen einzig und ausschließlich der geschichtlichen Bewegung, von deren Durchbruch in die Zukunft das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt. Ich diene auch als Dichter dem Befreiungskampf des Proletariats.
Gottfried Benn: Das ist noch etwas allgemein. Sie haben doch in Ihrer geistigen Entwicklung den Übergang vollzogen vom reinen Lyriker, also vom Dichter an sich, zum ausgesprochenen Tendenzdichter. Darf ich fragen, wie sind Sie zu diesem Entwicklungsgang gekommen?
Johannes R. Becher: Es ist richtig, auch ich habe an die Möglichkeit einer reinen Kunst geglaubt, denn ich habe an einen Geist geglaubt, der über den Wassern schwebt. Ich war demnach von der Souveränität und der Unabhängigkeit der Dichtung tief überzeugt, bis ich eines Tages auf Grund von Erkenntnissen Einsicht bekam in den Klassenmechanismus, der die Geschichte des Menschen und ganz besonders die heutige Geschichte der heutigen Menschen beherrscht. Es ist selbstverständlich, daß mit dieser für mich zentralen Erkenntnis sich auch ein Umbruch in meiner Dichtung vollziehen musste. Ich könnte sagen, ich stieg in meiner Dichtung von dem Himmel zur Erde herab, ich hob das Jenseits auch in meiner Dichtung auf. Ich erkannte, daß es nicht in erster Linie wichtig ist, welche Meinungen, welche Vorstellungen die Menschen über sich selbst haben, sondern, daß es darauf ankommt, welche Funktion die Menschen in der Geschichte einnehmen, was die Menschen wirklich sind. Ich erkannte, daß der reine Dichter, der ich zu sein glaubte, in Wirklichkeit ein höchst unreiner Dichter war, ein Dichter einer bestimmten Klasse, der bürgerlichen Klasse. Mein Glauben an die reine Dichtung hatte sich als eine Fiktion erwiesen. Immer hatte ich, wenn auch noch so versteckt, Klasseninhalte gedichtet, und die Tendenz bestand nicht nur in dem, was ich dichtete, sondern auch in dem, was ich nicht dichtete, was ich verschwieg. Und ich verschwieg damals in meiner ganzen Dichtung das, was ich heute ausspreche, daß die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Dieser Klassenmechanismus ist eine Zwangsstellung, es gibt kein Darüber, es gibt kein Heraus. Wir sind nicht Menschen, wir sind Klassenmenschen, Menschen der einen oder der anderen Klasse und auch die Dichtung ist klassengebunden, auch das Wort ist dem Klassengesetz untertan. Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und die Aufgabe dieser Zeit ist die Befreiung des Proletariats und darüber hinaus die Befreiung der gesamten Menschheit. Dieser Aufgabe dienen meine Dichtungen. Wer sich als Dichter dieser Aufgabe entzieht, hat sich der Aufgabe entzogen, die ihm als Mensch und Dichter von der Zeit gestellt ist. Es gibt auch für den Dichter keinen Sprung über die Aufgaben der Zeit hinweg in die Ewigkeit. Ich habe Ihnen damit ganz kurz den wesentlichen Teil des Getriebes aufgedeckt, nach dem meine Dichtung funktioniert. Sie fragen, was will ich mit meiner Dichtung erreichen? Will ich etwas erreichen? Nach all dem Vorhergesagten: Ja! Ich will mit vorstoßen, die Durchbruchstelle erweitern.
Gottfried Benn: Eine der glücklichsten Gaben an die Menschheit ist zweifellos ihr schlechtes Gedächtnis. Es übersieht höchstens ein bis zwei Generationen; daher ihr Optimismus, ihr »ruchloser Optimismus«, wie ihn Nietzsche nennt. Daher der Glaube jedes Zeitalters, Aufgang, Zenit und Gloriole des Entwicklungsprozesses zu sein. Ich bin überzeugt, daß mit den gleichen ideologischen Hypothesen, die Sie entwickeln, seinerzeit Dschingis-Khan in China eingerückt ist. Ich meine damit: Die Weltgeschichte als Ganzes ist äußerst fragmentarisch. Eine Offenbarung der Weltvernunft, die Verwirklichung einer Idee, wie es Hegel aussprach, kann man nicht feststellen. Sie faßt etwas an, und dann läßt sie es liegen, sie beginnt großartig und endet namenlos, sie übersteht den Niagara, um in der Badewanne zu ertrinken, und die Hegelsche Ansicht vom großen Mann als dem Geschäftsführer der Weltvernunft fällt auch ins Wasser. Die Weltvernunft läßt ihn im Stich, der große Mann ist auf sich selber angewiesen.
Zweitens: Eine Frage: Die soziale Bewegung. Soziale Bewegungen gab es von jeher. Die Klassenumschichtung war von jeher der eine Inhalt der Geschichte. Die Unteren wollten immer hoch, und die Oberen wollten nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt, seit Ägypten den Weihrauchhandel monopolisierte und babylonische Bankiers die Geldgeschäfte begannen! Sie nahmen zwanzig Prozent Debetzinsen, Hochkapitalismus der alten Welt, der in Asien, wie am Mittelmeer. Trust der Purpurhändler, Trust der Reedereien, Import und Export, Spekulationen, Heereslieferungen und Konzerne, und daneben immer die Gegenbewegung, einmal die Heloten-Aufstände in den kyrenischen Gerbereien, einmal die Sklavenkriege in der römischen Zeit. Die Unteren wollen hoch und die Oberen wollen nicht herunter, schaurige Welt, kapitalistische Welt! Aber nach drei Jahrtausenden Geschichte darf man sich wohl dem Gedanken nähern, daß das alles weder gut noch böse ist, sondern rein phänomenal. Knechtschaft scheint ein Zwang der Schöpfung zu sein und Ausbeutung eine Funktion des Lebendigen. Die Formulierung und die Theorie nun, die die soziale Bewegung vor einem halben Jahrhundert gefunden hat, ist nur eine von den Formulierungen und Theorien neben vielen anderen, die ihr widersprechen und die ihr gegenüberstehen. Schließlich enthält sie ja auch nichts so prinzipiell Neues. Daß das „Ich“ nicht in der Luft schwebt, daß der Mensch zu einem sozialen Verband gehört, daß das Individuum in manchen Teilen ein Exponent des Zeitkollektivs ist, das hat ja keine Epoche bestritten. Schließlich gibt es doch seit zweihundertfünfzig Jahren eine Nationalökonomie, und schon Hobbes sagte 1700, das Gute, das sei das Gemeinnützige. Ich kann also aus Gründen der Erkenntnis die soziale Bewegung, die sich vor unseren Augen abspielt und zu der Sie sich rechnen, nicht als eine klare Offenbarung, als eine sinnvollere Verwirklichung irgendeiner Wahrheit oder eines Menschheitsbildes und auch nicht als die Basis einer Weltanschauung ansehen. Ich sehe sie im Zuge und in der Folge aller der früheren sozialen Krisen und Kämpfe. Das klingt Ihnen vielleicht hart, aber in dieser Diskussion handelt es sich ja um Erkenntnis, und ich erinnere Sie nun nochmals an das Hegelwort – diesmal im positiven Sinne. Das Wort lautet: »Es ist ein großer Eigensinn, ein Eigensinn, der dem Menschen Ehre macht, nichts in der Gesinnung anerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken gerechtfertigt ist!« Und ich muss Ihnen sagen, mein Gedanke rechtfertigt Ihre Gesinnung nicht!
Nun: Dichtung und Politik!
Betrachtet man die Geschichte und die soziale Bewegung so, wie ich es in den beiden vorhergehenden Thesen tat, kann die Frage, ob und wie weit die Dichtung sich mit ihnen zu befassen hat, überhaupt nicht mehr auftauchen. Die politische Tendenz ist keine Tendenz der Dichtung, sondern eine Tendenz des Klassenkampfes; wenn sie sich in poetischer Form äußern will, ist das Zufall oder private Liebhaberei!
⇒ Dichtung an sich: Benn versus Becher
»Eine Offenbarung der Weltvernunft, die Verwirklichung einer Idee, wie es Hegel aussprach, kann man nicht feststellen. Sie faßt etwas an, und dann läßt sie es liegen, sie beginnt großartig und endet namenlos, sie übersteht den Niagara, um in der Badewanne zu ertrinken, und die Hegelsche Ansicht vom großen Mann als dem Geschäftsführer der Weltvernunft fällt auch ins Wasser. Die Weltvernunft läßt ihn im Stich, der große Mann ist auf sich selber angewiesen.«
Nun, wer hat gewonnen in diesem Kampf der Rhetoren? Neun von zehn werden sagen: Ganz eindeutig: Benn! Warum? Selbstverständlich muten die Ausführungen Benns wortgewaltiger an, und selbstverständlich wird bei der Vergabe unserer Sympathien auch die Rezeptionsgeschichte ein Wort mitsprechen, denn Benn gilt heute ganz gewiss als der „größere“, der bedeutendere Dichter, bedeutender vielleicht auch deshalb, weil unsere Gesellschaft eher ein Auge zudrückt, wenn weniger mit Stalin als mit Hitler “geliebäugelt” wird.
Der Brachialästhet Gottfried Benn hat sich abgefunden.
Sei dem wie dem sei! Dass der Sieg pro Benn ausfällt, hängt wohl eher damit zusammen, dass es leichter ist gegen etwas als für etwas zu sein. Zerstören ist leichter als aufbauen. Wenn Benn sich lustig macht über die Menschheit und ihren steten Glauben, „Aufgang, Zenit und Gloriole des Entwicklungsprozesses zu sein“, dann gelingt ihm zwar ein erbauliches Bonmot, allerdings will in seinen brachial-ästhetischen Schädel ums Verrecken nicht hinein, dass gerade Becher, als Anhänger Marx’scher Theorien und somit als Anhänger des Historischen Materialismus, dass gerade Becher gerade diesen Gedanken nun überhaupt nicht teilt. Benn, der sich ja immer wieder gerne auf Nietzsche berufen hat, frönt einem Nihilismus, der sich ganz im Sinne des nietzsche‘schen Übermenschen selbstverständlich nicht auf das ach so bedeutende Ich, wohl aber aufs Wir bezieht. Damit liegt er voll im Trend, denn »Unterm Strich zähl ich …«
⇒ Postbank: Unterm Strich zähl ich
Der bieder wirkende Johannes R. Becher möchte etwas bewegen.
In diesem (Dämmer-) Licht versteht man auch die Aussage „Knechtschaft scheint ein Zwang der Schöpfung zu sein und Ausbeutung eine Funktion des Lebendigen.“ Ja, wer das Ich als Zenit und Gloriole menschlichen Daseins ansieht, wer Lust an der simplen Aufgabe verspürt, sich über einen Fortschrittsglauben im humanistischen Sinne lächerlich zu machen, dem bleibt früher oder später nichts anderes übrig, als zu resignieren und sich abzufinden. Ich möchte mich nicht abfinden. Und ja, gar ertrinke ich gerne in meiner eigenen Badewanne, so ich denn davor den Niagara gemeistert und etwas probiert habe. Benn, um in seinem Bild zu bleiben, Benn plantscht als Kind auf Höhe von Seligenstadt im Main, um dann, im Erwachsenenalter auf Höhe von Seligenstadt im Main zu plantschen, um letztlich dann, nach einem wahrhaft einflussreichen und aufregenden Leben auf Höhe von Seligenstadt im Main zu ertrinken. Ich bin sicher: Dächten alle Menschen wie Benn, säßen wir noch immer in Höhlen und äugten sinnbefreit nach draußen, um den wunderschönen Astern beim Wachsen (und Vergehen) zuzuschauen.
⇒ Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewißheit wacht
Die Lyrik Benns kommt oft beeindruckend und gewaltig schön daher, ohne Zweifel, aber es geht ihr abhold ein Atem, der über das eigene Ich hinausgeht. Wir glauben, die Nietzesches und Benns hätten Recht behalten, weil sie vorhergesehen haben die Zeit, die wir jetzt vorzufinden ertragen müssen. Eine Zeit, in der unser Blick fast nur mehr noch Menschen wahrnimmt, die von Medikamenten sediert, von Drogen des Denkens beraubt und von Ziellosigkeit angeödet sind; ein Blick, der fast nur noch Menschen wahrnimmt, die um sich selber kreisen, tatsächlich etwas in sich suchen und glauben, dort etwas finden zu können… Wer macht diesen Menschen begreiflich, dass der Blick nach innen nicht nur unmöglich ist, sondern dass er, wäre er möglich, einzig auf Innereien fiele? Wer macht ihnen begreiflich, dass Erkenntnis und somit ein Ziel, ein Plan, ein Projekt nicht über das Ich, sondern ausschließlich über das Wir möglich ist?
Finden soll man die Magie
Stets in einem selbst.
Doch ich bin schuldig, weil ich denke:
Allein find ich sie nie!
Ingo Munz
Was, frage ich mich häufig, hält uns davon ab, auch den Bechers und Brechts Recht zu geben? Jenen also, die den gesamtgesellschaftlichen Burn Out vielleicht ebenfalls vor Augen hatten, sich aber damit nicht abfinden wollten? Wer hält heute unserer indolenten und ausschließlich ironisierenden Gesellschaft den Spiegel vor?
Ja, wer setzt denn den Kontrapunkt? Die Wirtschaft ist zügellos, außer Kontrolle, minderwertig. Die Politik und die Wissenschaft bestätigen nur mehr noch sich selbst und das, was gerade mehrheitsfähig ist. Die Medien lügen, lügen und lügen und sind ansonsten degeneriert auf die Funktion als Verkaufsplattform. Nicht wenige Menschen müssen vierzig und mehr Stunden wöchentlich arbeiten und sehen sich dennoch zum Bittstellergang auf das Sozialamt genötigt. Das Gesundheitswesen kalkuliert fröhlich mit der Krankerhaltung von uns Menschen. Es wird festgehalten und weiter geforscht an Technologien, die uns jederzeit töten könnten. Fremde Ländereien werden unter unserem meist stillschweigenden Einverständnis verpestet mit unseren Waffen, mit unseren meist schlechten Ideen, mit unseren Konsumgütern. Gibt es unter diesen Voraussetzungen tatsächlich nichts Sinnvolles zu tun? Gibt es tatsächlich einen Grund, den von vielen so herbeigesehnten Sinn im eigenen Innern zu suchen?
Ich will nicht ich sein, ich will wir sein.
(Michail Alexandrowitsch Bakunin, russischer Revolutionär und Anarchist)
Brechts Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters«, das will ich eingestehen, kann stilistisch und ästhetisch nicht mit Benn oder Rilke konkurrieren – und dennoch ist es mir unter den hier aufgeführten Gedichten das liebste! Tauche ich ein in die Fragen des lesenden Arbeiters und rufe mir meine drei Forderungen ins Gedächtnis (poetisches Lebensgefühl, Verzicht auf den Verstand, hinaus übers Ich und hinein ins Wir), so könnte ich, Brechts sonstiges Werk unberücksichtigt, an der Einhaltung der ersten Forderung zweifeln, müsste die zweite Forderung als nicht erfüllt ansehen und sähe allein die dritte Forderung vollauf verwirklicht. Bei Benn und Rilke verhält es sich annähernd umgekehrt. Ja, ich kenne kein Gedicht, leider auch kein eigenes, das allen drei Forderungen gerecht würde. Doch was heißt leider? Es gibt etwas zu tun! Wer nichts wagt, ist schon gescheitert!
Ingo Munz
Fragen eines lesenden Arbeiters
Wer baute das siebentorige Theben
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon,
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war,
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Über wen>
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
Brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang,
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte,
So viele Fragen.
Achtung, Theorie! Was bedeuten Prosa, Drama, Lyrik?
Warum sich der Inhalt die Form sucht
Literarisches Verständnis: Prosa
Starker Tobak! Warum, wer sendungsbewusst ist, am besten Prosa verfertigt und Antwort auf die Frage, wessen Romane zwar gerne gelesen, aber auch schnell wieder vergessen werden.
Literarisches Verständnis: Drama
Der ewige Goethe hängt kopfüber vom Schnürboden eines Stadttheaters herab. Neben ihm: Ingo Munz und ein gewisser Lovis Löwenthal. Es gibt den Faust. Und es geht sehr ordentlich zur Sache!
Literarisches Verständnis: Lyrik
Warum Lyrik weniger mit Handwerk zu tun hat als die meisten denken. Und endlich Aufklärung darüber, warum Ingo Munz Johannes R. Becher Gottfried Benn vorzieht.

Empfehlungen
aus dem »Verlag Ingo Munz« zum Thema Lyrik




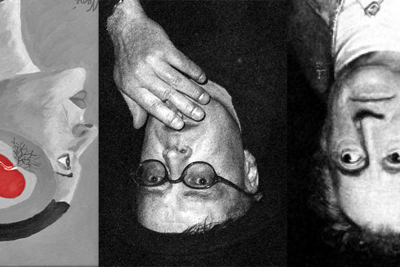






Lyrik bedeutet für mich als einfache Gernleserin zuerst: Tempo drosseln, laaaaangsam lesen… mich drauf einlassen und: einem Stück aus der Welt Gehobenem Raum in mir geben. Ich empfinde Gedichte als Bruchstücke, als Edelsteine, welche roh oder geschliffen einen ganz besonderen Zauber haben.
Diese lasse ich auf mich wirken in Klang und Wortwahl und Rhythmus. Und sie ergreifen mich – oder auch nicht. Manchmal wenden sie sich an meinen Intellekt, manchmal packen sie mich an meinen Sehnsüchten oder spiegeln Gefühle, die mir oft vorher nie deutlicher waren.
Gedichte sind mir Miniaturen unterschiedlichster Art.
Manchmal brauchen beide Seiten Geduld, bis Resonanz eintritt – wie bei Ingo Munz’ ‘Altenessen’, dessen Zauber sich mir nicht beim ersten Lesen erschloss. Manchmal ergötzen leichte Wortspielereien. Manchmal dringen Metaphern direkt bis ins Mark.
Gottfried Benns kraftvolle Schöpfungen haben mich in meiner Oberstufenzeit schwer beeeindruckt und zum Nachdenken bewegt. Mit Goethe habe ich Leidenschaft gefühlt und er hat mich darüber Sinnieren machen, wohin sie einen trägt. Brechts Schnoddrigkeit ist unvergessen und mahnt bis heute.
Muss Lyrik etwas?